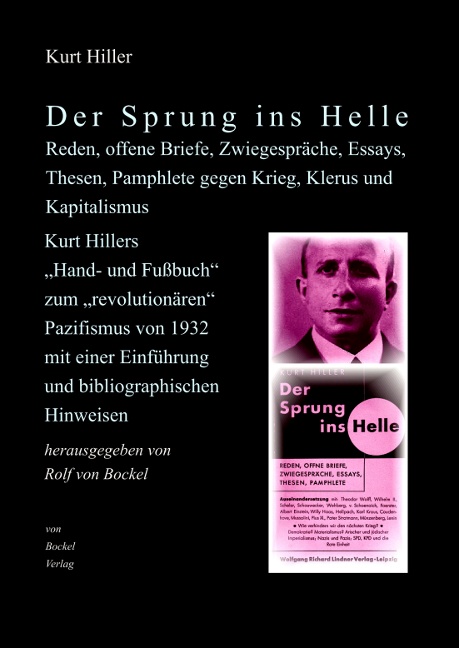Kurt Hiller:
Der Sprung ins Helle
Reden, offene Briefe, Zwiegespräche, Essays,
Thesen, Pamphlete gegen Krieg, Klerus und Kapitalismus.
Kurt Hillers „Hand- und Fußbuch“ zum „revolutionären“ Pazifismus von 1932,
mit einer Einführung und bibliographischen Hinweisen.
Hrsg. von Rolf von Bockel. 496 S., ISBN 978-3-95675-046-5, 29,80 Euro
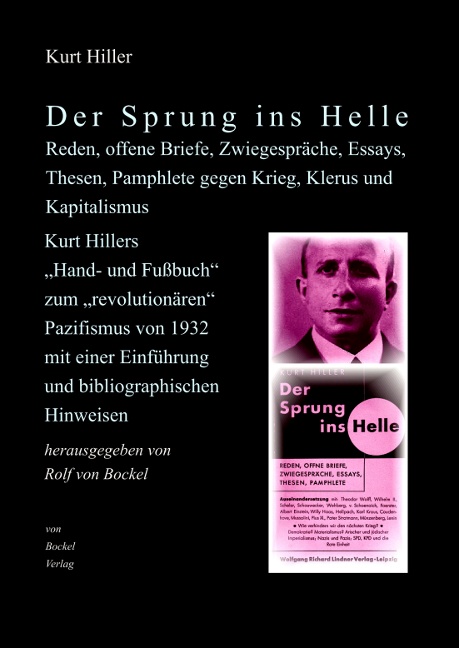
Zum Erwerb des Buches über booklooker.de bitte hier klicken ==>
Als die „Internationale der
Kriegsdienstgegner“ 1931 in Lyon tagte und Albert Einstein eine
Grußbotschaft an die Teilnehmer mit der Hoffnung schickte, sie
könnten „zu einer größeren Weltmacht werden als
das Schwert“, reagierte Kurt Hiller in einem öffentlichen
Brief, der in der „Weltbühne“ erschien: „Einen
Schritt noch, Einstein!“ Darin mahnte Hiller, man könne
angesichts der kriegstechnologischen Entwicklung zur Verhinderung
drohender Kriege nicht mehr nur auf Dienstverweigerung setzen.
„Es ist eine Naivität, hochverehrter Herr Professor, die
unbeschreibliche Entsetzlichkeit eines kommenden Krieges, mit seinen
Spreng-, Brand-, Bazillen- und Giftgasbomben über den
Großstädten, dadurch glauben bannen zu können, dass man
die Menschen auffordert, sich nicht an ihm zu beteiligen.“ Der
„Weltbühne“-Autor und einstige
„Absolutpazifist“ argumentierte weiter, es gebe nur
„ein einziges wirklich taugliches Mittel zur Verhinderung des
gigantischen Verbrechens: die revolutionäre Erhebung gegen die
Verbrecher, die Eroberung der politischen Macht.“ In seinem
Antwortbrief unterstrich Einstein noch einmal die psychologische
Wirkung der Kriegsdienstverweigerung.
Kurt Hillers „Sprung ins Helle“ erschien 1932 und
enthält seine wesentlichen Schriften – wie auch Brief- und
Rundfunkdiskussionen – zu seinem ab 1925/26 propagierten
„revolutionären“ Pazifismus. Leute wie Kurt Tucholsky,
Walter Mehring, Ernst Toller u. a. gehörten Hillers 1926
gegründeter „Gruppe Revolutionärer Pazifisten“
an. Persönlichkeiten wie eben Einstein, Klaus Mann, der
Völkerrechtler Hans Wehberg oder der Ordenspriester Franziskus
Maria Stratmann u.a.m. korrespondierten mit Hiller zu Fragen des
Pazifismus. Der „Weltbühne“-Autor hatte eine weite
Reputation.
Weitere Themen in dem Buch sind neben Kriegsdienstverweigerung und der
Gewaltproblematik u. a.: Sozialismus-Vorstellungen, Kapitalismus,
Klassenkampf und kriegerische Gewalt, „Experiment“
Russland, Revolution, Kriegstechnologie und Friedensstrategien, Genfer
Völkerbund, „Pan-Europa“-Bewegung, Nationalismus,
Kriegsschuldfrage am Ersten Weltkrieg und Revisionismus.
Das Buch – 11 Monate vor der Machtübergabe an Hitler
erschienen – war lange Zeit schwer zugänglich. Der
größte Teil der 1932-Auflage wurde vernichtet. Hiller kam
schon 1933 ins KZ, konnte aber 1934 nach Prag fliehen. Obwohl das Buch
1932 in vielen Zeitschriften besprochen wurde und bekannt war, lag es
ab 1945 nur selten in Bibliotheken vor.
Der jetzt vorliegende Neudruck ist mit einer Einleitung zu Hillers
Pazifismus, zur Geschichte des Buchs, ergänzenden Materialien und
bibliographischen Hinweisen versehen. Es ist ein wichtiges Dokument zu
Kurt Hillers geistesgeschichtlicher Entwicklung, zur Geschichte linker
Intellektueller am Ende der Weimarer Republik und zur Geschichte des
„Pazifismus“ in Deutschland.
Richard Huelsenbeck (1892-1974) schrieb 1932 in der
„Literarischen Welt“: „Es gibt in diesem Augenblick
kein aufschlussreicheres Buch über Fragen, die uns deutsche
geistige Menschen aufs Dringendste angehen.“
Max Brod (1884-1968) schrieb im Prager Tageblatt: „So wird
Hillers Buch zum kühnen, doch ausgewogenen und mit aller
Konsequenz eines selbständigen Denkers durchgebildeten Versuch,
jene Position des Menschen aufzuspüren, von der aus er zur
gerechten und glücklicheren Zukunft vorbrechen könnte.“
Der französische Schriftsteller Romain Rolland (1866-1944) schrieb
in einem Brief an Hiller: „Ich freue mich, oft bei Ihnen zu
lesen, was ich selber denke. Und in manchem – so hinsichtlich
Prof. A. Einstein – ist unsere Übereinstimmung
frappant.“